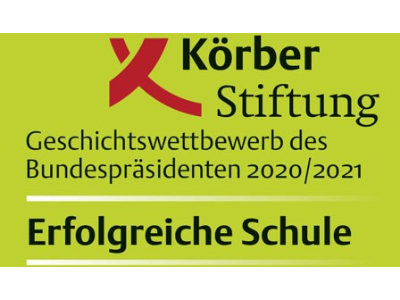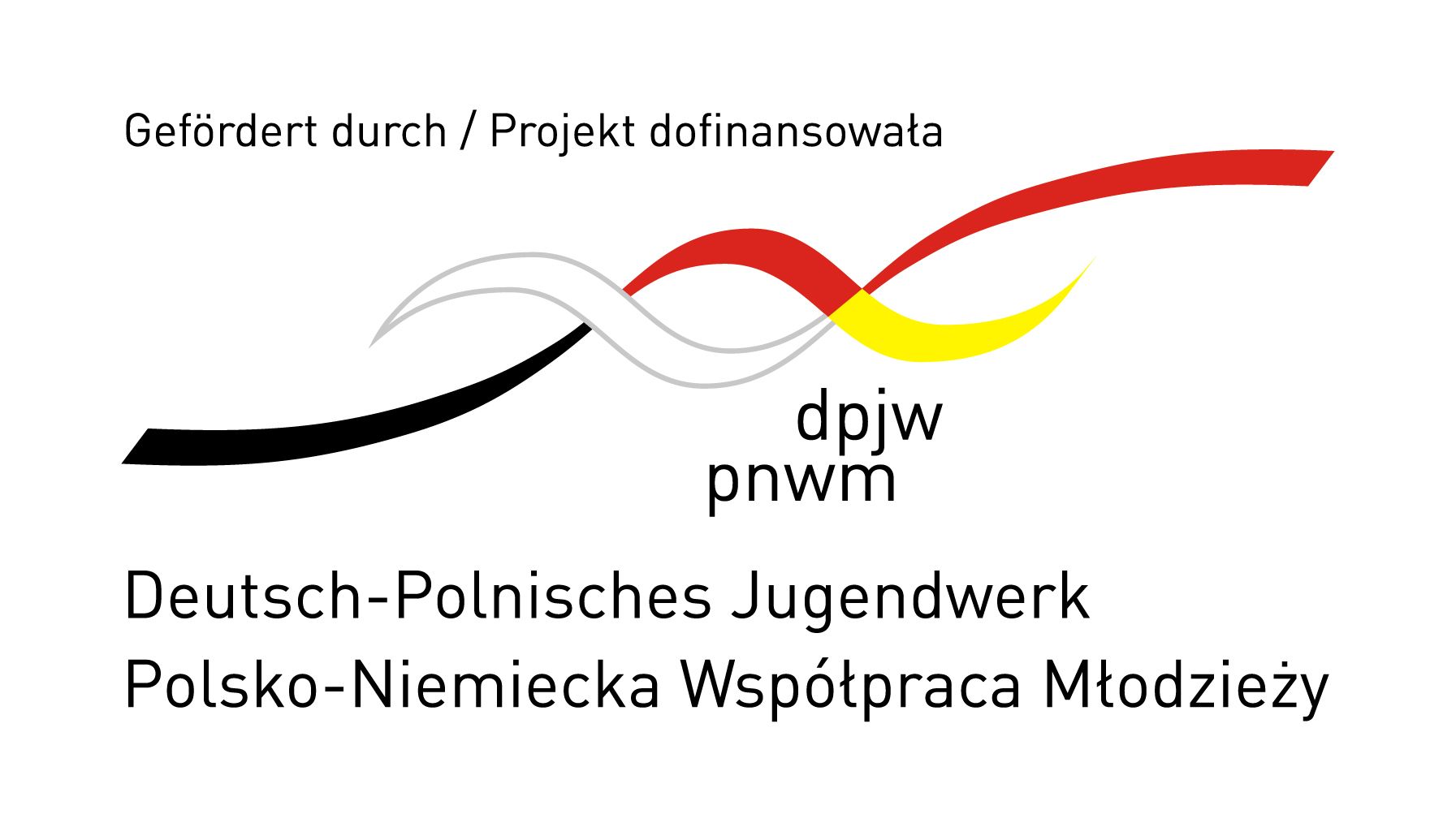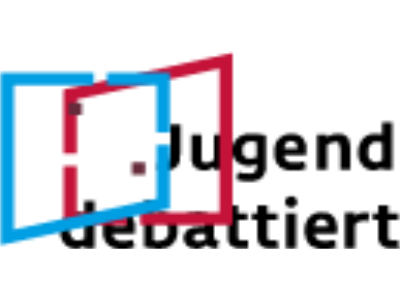Zeitzeugen im Geschichtsunterricht
Eva Schupp erinnert sich an die NS- und die Nachkriegszeit und Daniel Kruse berichtet über seine Erfahrungen mit der DDR
Anfang Juni besuchte Eva Schupp aus Haigerseelbach (geb. 1931) die Klasse 10E der Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) im Rahmen des Geschichtsprojektes „Unsere Zeitzeugen – unsere Geschichte“ unter der Betreuung des Fachlehrers Paul Sajon. Die Zeitzeugin beantwortete Fragen zur deutschen Geschichte von 1933 bis 1990 aus lokaler Perspektive.
Wie haben Sie die Veränderungen im Alltag nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten erlebt? Was haben Sie in der Schule oder Ihre Eltern bei der Arbeit über Hitler und die Nazis gehört
Eva Schupp: Vorweg möchte ich sagen, dass mein Vater am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat und wusste, was der Krieg bedeutet. Heute würde man ihn „Kriegsgegner” bzw. „Friedensbefürworter” nennen. Diese Grundeinstellung herrschte auch in unserer Familie. Nicht alle im Volk glaubten Adolf Hitler. Hitler hat aber – propagandistisch – versucht, hohe Zustimmung im Volk zu bekommen durch z.B. KDF-Urlaub oder das Prora-Projekt auf Rügen, die beide staatlich bezuschusst wurden. Auch das Gefühl der „Volksgemeinschaft” wurde mit verschieden Maßnahmen staatlich gefördert. Ich war z. B. bei dem BDM (Bund Deutscher Mädel). Mir haben damals die Gemeinschaft mit anderen Mädchen, Lieder am Lagefeuer sowie die Uniform gefallen. Es war für mich schön – etwas Neues, Aufregendes. Weiter habe ich damals nicht gedacht...
Haben Sie im Krieg der NS-Propaganda geglaubt oder Zweifel gehabt – und konnte man diese Zweifel damals überhaupt äußern? Wie war die Versorgung mit Lebensmitteln und Kleidung in der Kriegszeit? Wie war der Kriegsalltag?
Eva Schupp: Nach meinem Wissen gab es nur zwei Männer im Dorf, die überzeugte Nazis waren. Der Rest war zurückhaltend und (innerlich) ablehnend dem Nationalsozialismus gegenüber. Es herrschte eher eine Atmosphäre der Angst. Öffentlich wagte niemand, die Regierung oder den Krieg zu kritisieren. Zu Hause – im privaten Kreis – war es anders, auch wenn die Erwachsenen wegen der Kinder vorsichtig sein mussten. In der Wochenschau hat man nur das gezeigt, was gut war: Heil und Sieg! Auch den Germanenkult – manche Leute wurden hellhörig. Trotzdem gab es viele Christen, die auf der NS-Seite standen, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist.
Gab es besondere Erlebnisse während des Krieges, die Sie bis heute nicht vergessen haben?
Eva Schupp: Ja – die Einziehung meines Vaters Ende August 1939 zur Wehrmacht. Wir alle standen am Bahnhof in Haiger und haben geweint. Mein Vater auch. Im Krieg haben wir nicht gehungert, obwohl natürlich im Vergleich zu heute das Lebensmittelangebot sehr gering war. Kleidung und Sonstiges konnte man nur auf Bezugsscheine bekommen – auch mehrere Jahre nach 1945 war es so.
Haben Sie Plünderung und Gewalt mitbekommen (vielleicht in Ihrem Dorf)?
Eva Schupp: Im Krieg selbst nicht. Andere Orte, wie z.B. das Haigerer Zentrum wurden bombardiert. Am Ende des Krieges kamen ca. 15 US-Soldaten ins Dorf und sie haben einiges an Wohnungseinrichtung zerstört, z.B. Federbetten zerschnitten und einige Schränke auf der Suche nach Waffen kaputtgemacht. Die Amerikaner kamen auch in unsere Wohnung – für eine Nacht – und der US-Offizier hat meiner Mutter zugesichert, dass ihr und den Kindern nichts passiert. So war es auch. Wir bekamen sogar zwei Tafeln echte Schokolade, was wir nicht kannten. Bei uns zu Hause wurde nichts zerstört.
Hatte man Angst vor dem Krieg oder war man stolz, dass Deutschland Gebiete erobert? Wie war die Stimmung nach dem verlorenen Krieg und gab es Chaos?
Eva Schupp: Während des Krieges kann ich mich an das Angstgefühl erinnern. Viele hatten Angst. Offiziell sprach man von „Endsieg”, aber die Menschen waren gespalten.
Nachdem der Krieg zu Ende war, gab es eine allgemeine Erleichterung, dass alles nun vorbei ist. In der Schule bekamen Schüler Milch und sogar Kakao von den Amerikanern. Kakao kannte ich bis dahin nicht. Da wir aber eine Kuh hatten, stand mir und meinem Bruder nichts zu.
Erinnern Sie sich an die Währungsreform von 1948 und wie diese Ihr Leben beeinflusst hat?
Eva Schupp: Das, was wir im Krieg und nach 1945 gelernt haben, war das Überleben. Meine Mutter musste sich um den Haushalt kümmern, alleine zwei Kinder und sich versorgen. Der Vater kam erst 1947 aus sowjetischer Gefangenschaft, körperlich und psychisch gebrochen, zurück. Es war schwer mit ihm auszuhalten. Ich musste die ganze Zeit im Haushalt und „Hof” helfen. Wir hatten zwei Kühe und zwei Schweine sowie Geflügel. Das war sozusagen unsere Lebensversicherung.
Bei der Währungsreform bekam jeder 40 DM „Kopfgeld”. Man konnte plötzlich alles im Geschäft kaufen. Unsere Sparbuch-Ersparnisse für das Haus waren aber plötzlich auch kaum etwas wert. Es musste aber irgendwie weitergehen – egal ob vor oder nach der Währungsreform. Z. B. viele haben Schweine und Kühe schwarz geschlachtet. Einige wurden angezeigt, die meisten aber nicht. Der Vater hat den Schnaps schwarz gebrannt, dann gegen Tabak getauscht und Tabak gegen Zement. Die Mauersteine mussten wir selber machen. So hat man sich geholfen und gebaut. Die Menschen mussten erfinderisch sein - nur so hat man überlebt.
Wie war es als Frau in der Zeit nach dem Krieg?
Eva Schupp: Nach der achten Klasse war die Frage nach einem Beruf für viele Mädchen damals hinfällig – für mich auch. Sie mussten im Haushalt kräftig mithelfen. Die Rollen waren klar vorgegeben: Eine Frau sollte sich um den Haushalt kümmern und eine gute Ehefrau und Mutter werden. Und damals mit 15/16 Jahren hatte ich keine Gedanken für Politik verschwendet. Wir wollten leben; es galt das Praktische, der Alltag – und natürlich Jungs. Mein männliches Ideal waren damals „Rambos” und „Machos”. Heute kann ich gar nicht sagen, warum – was ich mir dabei gedacht habe. Jungen Frauen heute kann ich nur raten: lernt viel, strebt eine gute Ausbildung an und seid finanziell unabhängig.
Wie hat man über die DDR gedacht?
Eva Schupp: Wir waren froh, dass wir dort nicht leben mussten, denn man hörte u. a. von Enteignungen. Die DDR war etwas Ungutes, Fremdes und dazu relativ weit von uns entfernt. Einmal haben wir mit dem Bus Schkeuditz bei Leipzig, eine Partnergemeinde, besucht. An der Grenze mussten wir die Pässe abgeben – ein mulmiges Gefühl. Es gab auch aus irgendeinem Grund lange Schlangen vor einem Restaurant. Als wir zurück im Westen waren, war es ein befreiendes Gefühl.
Gab es für Sie einen bestimmten Moment, in dem Sie besonders stark gespürt haben, was die deutsche Teilung bedeutet? Wie haben Sie den Fall der Berliner Mauer 1989 erlebt?
Eva Schupp: Das, was zusammengehörte, wurde auf einmal 1945 zerrissen. Nach 1945 wurden anderen Familien im Dorf Heimatvertriebene aus dem deutschen Osten zugewiesen. Ich habe diese Menschen aber nie als „Fremdkörper” empfunden. Sie taten mir leid.
Unsere Familie hate keine Verwandtschaft drüben, daher hatten wir auch keine engere Beziehung zur DDR. Als die Mauer 1989 fiel, war ich überrascht und froh, dass es friedlich geschah. Ich habe auch nie gedacht, dass es noch dazu kommt. Ein Satz gefällt mir besonders gut: Freiheit ohne Ordnung ist Anarchie; Ordnung ohne Freiheit ist Diktatur. Dazwischen ist die Demokratie – die angenehmste Regierungsform. Wir sollten dafür dankbar sein. Und der Krieg ist immer die schlechteste Lösung – er bringt nur Elend und Zerstörung und zwar allen.
Noch in vielen weiteren Beispielen konnte Frau Schupp intensive Einblicke in die vergangenen Zeiten vermitteln. Dabei beeindruckte sie durch präzise Erinnerungen und eine klare Sprache. Das kam bei den Schülern an, wie die nachfolgenden Eindrücke zeigen.
„Ich fand, dass die Zeitzeugin sehr ehrlich und authentisch von ihren Beobachtungen berichtet hat.”
„Die Zeitzeugin hat die Fragen vielleicht besser beantwortet als eine Internet-Recherche.”
„Ich finde es bemerkenswert, dass eine fast Hundertjährige sich vor eine Klasse stellt und über ihre Vergangenheit spricht.”
„Es war spannend zu hören, wie das Leben damals in meinem Nachbardorf war.”
Anfang Juli wurde das Zeitzeugenprojekt in der Klasse 10E fortgesetzt. Diesmal hatte Geschichtslehrer Paul Sajon Daniel Kruse aus Mittenaar (geb. 1976 in Magdeburg) eingeladen. Er berichtete über die DDR-Geschichte der 1980er Jahre aus der Sicht eines jugendlichen Regime-Gegners.
Daniel Kruse wurde 1982 in die Polytechnische Oberschule, eine 6-Wochentage-Ganztagsschule unter Schirmherrschaft der Stasi eingeschult. Eine Schule mit hohem Lernniveau, auf der durch den militärkundlichen Schulschwerpunkt u.a. Scharfschießen, Granatenwerfen und sogar Nahkampf mit Messer geübt wurde. Die Kampf- und Schießübungen gefielen ihm, auch wenn seine Mutter eigentlich dagegen war. Die Familie – auch Herr Kruse als Kind und Jugendlicher – war stark christlich geprägt (Baptisten) und hat eigentlich das DDR-Regime abgelehnt. So war Daniel Kruse – als einziger Schüler – nicht in der FDJ, was seitens der Schule Schikanen und Erniedrigung mit sich brachte. Ihm wurde irgendwann deutlich signalisiert, dass deshalb Abitur und Studium, trotz guter Noten, in der DDR nicht möglich wären.
Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Eltern haben Ende 1986 offiziell einen Ausreiseantrag gestellt, der aber aufgrund der politisch-wirtschaftlichen Systemrelevanz der Berufe der Eltern über zweieinhalb Jahre „bearbeitet” wurde.
In dieser Zeit wurde die Familie „erkennungsdienstlich” durch die Stasi bearbeitet: U.a. wurde das ganze Haus verwanzt und jede Bewegung der Familie überwacht. Es gab auch Stasi-IM (Inoffizielle Mitarbeiter) in der Familie.
„Das alles geschah, um uns zu zermürben und zu zersetzen.” – so Kruse. „Man konnte auch privat niemandem vertrauen, denn man musste damit rechnen, dass immer ein Spitzel dabei ist.”
„Nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik Mitte Oktober 1989 ging ich praktisch unverzüglich auf die Johann-Textor-Schule in Haiger. Mit den plötzlichen Freiheiten in der Schule kam ich gar nicht klar.” Er stand auch voll in der Pubertät. Es waren keine einfachen Jahre für Daniel Kruse: „Enttäuscht war ich auch, weil ich der Überzeugung war, die Bundesrepublik sei ein christliches Land; aber ich musste anerkennen, dass die Realität anders und komplexer war.”
Immer mehr und mehr galt Kruse in der Schule als der „blöde Ossi”, und er hat sich auch oft geprügelt. Kruse hatte plötzlich keine Ostidentität - aber auch keine Westidentität. Rückblickend habe sich aber sein Leben insgesamt zum Guten gewendet, denn er hat das Abitur geschafft und dann erfolgreich studiert. Kruse: „Nun bin ich in Mittelhessen fest verwurzelt und fühle mich hier wohl.”
Die Frage, ob ihn die DDR geprägt habe, bejaht Daniel Kruse. Er nannte in diesem Zusammenhang Disziplin als etwas Gutes und auch die Bundeswehr, die uns in einem Verteidigungsfall beschützen sollte. Mit dem Begriff „Sozialismus” hatte er große Schwierigkeiten, wobei er die Förderung des Gemeinwohls und im Speziellen die staatliche Kulturförderung, eine qualifizierte, kostenlose und flächendeckende Kinderbetreuung in der DDR gut fand. Falls die Bundesrepublik diese DDR-Ideen übernommen und umgesetzt hätte, wäre das nur positiv für unsere Gesellschaft, meinte er.
Daniel Kruse bewertete die DDR insgesamt kritisch – vor allem wegen der fehlenden Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und des übermächtigen Unterdrückungsapparats. Den nötigen Halt in der DDR – aber auch heute – gibt ihm der tiefe Glaube und die Gemeinde.
- 2025
- copyright Text: Paul Sajon, WvO
- copyright Foto: Paul Sajon, WvO